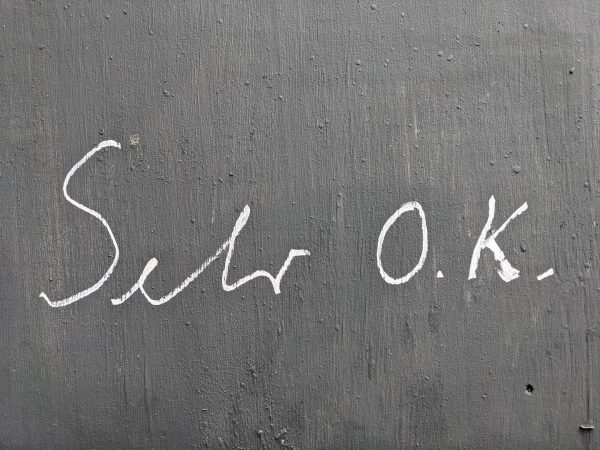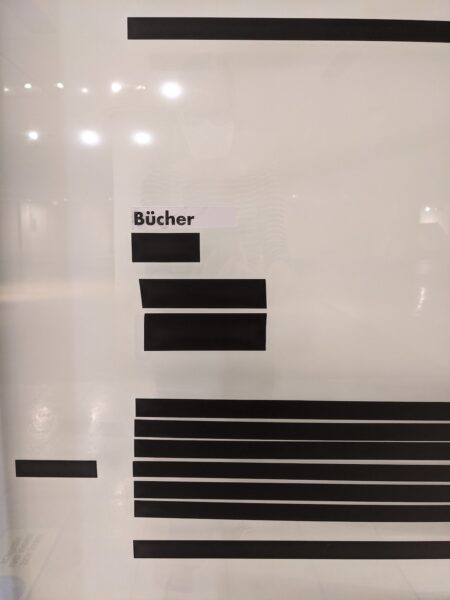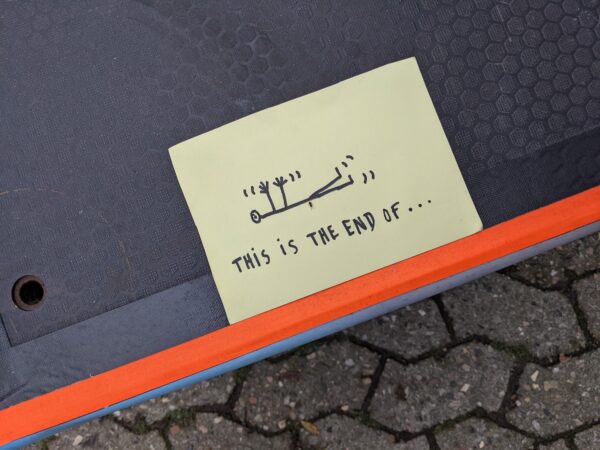Die diesjährige Ausbeute war eindeutig zu mager: Zu ganzen vier Veranstaltungen habe ich es während des Internationalen Sommerfestivals 2023 auf Kampnagel geschafft. Immerhin, drei davon verbuche ich als Highlights.
(La) Horde/Ballet national de Marseille: Age of Content
Das Eröffnungsstück von (La)Horde und dem Ballet national de Marseille gehörte – für mich überraschenderweise – leider nicht dazu.
Zum einen verstand ich die Story nicht, zum anderen war das Werk schlicht gute 15 bis 20 Minuten zu lang. „Marry me in Bassiani“ hatte mir seinerzeit ganz gut gefallen, „Age of Content“ hat mich dagegen gar nicht überzeugt. Schade.
Walid Raad: Cotton Under My Feet – The Hamburg Chapter
Das war ein ziemlicher Ritt durch die Hamburger Kunsthalle, denn dort spann Walid Raad entlang von im Gebäude des historischen Gründungsbaus verstreuten Objekten aus Fiktion und Historie (s)eine Geschichte. Zunächst schienen es nur Fragmente zu sein, die da teils im atemberaubenden Tempo und in schnellen Wechseln vorgetragen wurden. Doch nach und nach verdichteten sich die Bruchstücke, einem Mosaik nicht unähnlich, zu einem großen, verwirrenden Ganzen – letztlich, so eine der Botschaften, hängt doch alles mit allem zusammen, wenn auch bisweilen auf recht absonderliche Art und Weise.
Das Tempo, zudem in englischer Sprache, mag nicht für jeden vor Ort ideal gewesen sein. Die allermeisten Gesichter – oder so kam es mir jedenfalls vor – spiegelten aber mein eigenes Empfinden wieder: aus anfänglicher Skepsis wuchs Faszination bis hin zur Begeisterung. „Cotton Under My Feet – The Hamburg Chapter“ ist übrigens noch bis einschließlich 12. November 2023 per Audioguide oder in weiteren weiteren Live-Terminen zu sehen, zu hören und zu erleben.
Nesterval: Die Namenlosen – Verfolgt in Hamburg
Unter Unterhaltung fällt „Die Namenlosen – Verfolgt in Hamburg“ nicht. In dem Stück, welches die Verfolgung Homosexueller während der Nazizeit in Hamburg nachzeichnet, wird das Publikum nicht geschont. Man kann es Pech nennen oder auch Glück, dass ich von Anfang bis zum Ende durchgehend der unsympathischsten (und mutmaßlich auch mit weitem Abstand sadistischsten) Figur gefolgt bin. Auf diese Weise bekam ich das volle Programm geboten, inklusive einer drastischen Folterszene. Das war herausfordernd. Gelinde gesagt. Nicht umsonst wurde zu Beginn der Vorstellung auf die Möglichkeit verwiesen, sich jederzeit herausziehen zu können und ich habe nicht nur nach dieser einen Szene ernsthaft darüber nachdenken müssen. Dabei hatte ich nicht einmal alles gesehen. Theoretisch konnte man im ehemaligen Kakaospeicher Baakenhöft über 180 Szenen als Zuschauer in Begleitung und aus der Perspektive der Charaktere erleben. In drei Stunden Spielzeit schafft man davon aber nur einen Bruchteil. Aus meiner Sicht hat das mir schon aus „Sex & Drugs & Budd’n’brooks“ bekannte Format des begleiteten Szenenwechsels auch bei diesem schweren Thema gut funktioniert – vielleicht ein wenig zu gut, ich habe lange gebraucht, bis ich den Abend einigermaßen verarbeitet hatte. Anderen ging es anders, an einer Stelle fiel gar das Wort „Holocaust-Kitsch“. Zugegeben, das Schlussbild („Niemals vergessen“) war vielleicht ein klein wenig drüber, aber meinen Gesamteindruck konnte das nicht schmälern. Ich bleibe dabei: gerne jederzeit wieder Nesterval. Thema egal.
Graindelavoix: Rolling Stone
Das Konzert fand am letzten Festivaltag in Kooperation mit dem Elbphilharmonie Sommer im Großen Elphi-Saal statt.
Ein bisschen musste ich mich leider ärgern: Im ersten Teil des Konzerts wurde ein Film auf eine weiße Leinwand projiziert, die vermutlich nicht ganz zufällig einem Leintuch glich; geht es doch in der „Erdbebenmesse“ von Atoine Brumel um jenes Erdbeben, welches der vom Grab Jesu wegrollende Stein verursacht haben soll. Auch in dem gezeigten Dokumentarfilm von 1967 wurde diese Erzählung aufgegriffen. Allein, gesehen habe ich so gut wie nichts davon: Auf den Seitenplätzen hatte man die „Leinwand“ nämlich im Querschnitt vor der Nase. Das hätte ich gern vorher gewusst. Aber letztlich war ich wegen der Musik da, nicht wegen des Drumherums, und an dem musikalische Part gab es wenig zu kritisieren. Beeindruckend.
Zum Festival Avant-Garten kann ich mich nicht verhalten, ich war nämlich gar nicht dort (außer am Eröffnungstag). Das kommt davon, wenn man die Veranstaltungen in die gesamte Stadt verstreut! So schön, spannend und interessant das im Einzelfall ist: Das richtig echte Festival-Feeling kommt dadurch eindeutig zu kurz.